Dino Buzzati : Le K
Ah que coucou !
Aujourd’hui je vous propose un recueil de nouvelles du très célèbre écrivain italien : Dino Buzzati, mais comme je ne peux légalement le mettre en ligne, je vous en mettrai un passage au-dessous de ma signature…
Ce recueil regroupe les nouvelles suivantes :
ü Le K (nouvelle qui a donné son titre au dit recueil)
ü La Création
ü La leçon de 1980
ü Général inconnu
ü Le Défunt par erreur
ü L’Humilité
ü Et si ?
ü A Monsieur le Directeur
ü L’Arme secrète
ü Un amour trouble
ü Pauvre petit garçon
ü Le casse-pieds
ü Le compte
ü Week-end
ü Le secret de l’écrivain
ü Petite histoire du soir
ü Chasseurs de vieux
ü L’œuf
ü Dix-huitième trou
ü Le veston ensorcelé
ü Le chien vide
ü Douce nuit
ü L’Ascenseur
ü Les Dépassements
ü Ubiquité
ü Le Vent
ü Teddy Boys
ü Le Petit ballon
ü Suicide au parc
ü La chute du saint
ü Esclave
ü La Tour Eiffel
ü Jeune fille qui tombe… tombe
ü Le Magicien
ü La Boite de conserves
ü L’Autel
ü Les bosses dans le jardin
ü Petit Circé
ü L’épuisement
ü Quiz aux travaux forcés
ü Iago
ü Progressions
ü Les deux chauffeurs
ü Voyage aux Enfers du siècle
Vu le nombre de nouvelles, il est un peu difficile d’expliquer ce qu’est ce Recueil qui est pourtant un véritable délice à lire car très bien traduit par Jacqueline Remillet. Dino Buzzati a une façon bien personnelle pour surprendre le lecteur, en lâchant des indices ici et là mais… comment expliquer ça mieux qu’en lisant ses œuvres ? Là, j’avoue, le vocabulaire me manque pour traduire exactement ma pensée ;) – oui, ça arrive ;) mdrrrr ! Quoi qu’il en soit, sachez que Dino Buzzati nous transporte ici au cœur même de son histoire et nous tient en haleine jusqu’à la fin. Et on peut essayer de tricher en lisant les dernières pages, on se retrouve avec l’envie de la reprendre du début, même quand on connait déjà la chute ;) (comment je le sais ? J’ai essayé pour mes fiches de lecture qu’on nous faisait faire en cours de français ;)…)
Bisous,
@+
Sab
Le Pauvre Petit Garçon
Comme d’habitude, Mme Klara emmena son petit garçon, cinq ans, au jardin public, au bord du fleuve. Il était environ trois heures. La saison était ni belle ni mauvaise, le soleil jouait à cache-cache et le vent soufflait de temps à autre, porté par le fleuve.
On ne pouvait pas dire non plus de cet enfant qu’il était beau, au contraire, il était plutôt pitoyable même, maigrichon, souffreteux, blafard, presque vert, au point que ses camarades de jeu, pour se moquer de lui, l’appelaient Laitue. Mais d’habitude les enfants au teint pâle ont en compensation d’immenses yeux noirs qui illuminent leur visage exsangue et lui donnent une expression pathétique. Ce n’était pas le cas de Dolfi ; il avait de petits yeux inisignifiants qui vous regardaient sans aucune personnalité.
Ce jour-là, le bambin surnommé Laitue avait un fusil tout neuf qui tirait même de petites cartouches, inoffensives bien sûr, mais c’était quand-même un fusil ! Il ne se mit pas à jouer avec les autres enfants car d’ordinaire ils le tracassaient, alors il préférait rester tout seul dans son coin, même sans jouer. Parce que les animaux qui ignorent la souffrance de la solitude sont capables de s’amuser tout seuls, mais l’homme au contraire n’y arrive pas et s’il tente de le faire, bien vite une angoisse encore plus forte s’empare de lui.
Pourtant quand les autres gamins passaient devant lui, Dolfi épaulait son fusil et faisait semblant de tirer, mais sans animosité, c’était plutôt une invitation, comme s’il avait voulu leur dire : « Tiens, tu vois, moi aussi aujourd’hui j’ai un fusil. Pourquoi est-ce que vous ne me demandez pas de jouer avec vous ? »
Les autres enfants éparpillés dans l’allée remarquèrent bien le nouveau fusil de Dolfi. C’était un jouet de quatre sous mais il était flambant neuf et puis il était différent des leurs et cela suffisait pour susciter leur curiosité et leur envie. L’un d’eux dit :
« He ! vous autres ! vous avez vu Laitue, le fusil qu’il a aujourd’hui ? »
Un autre dit :
« La Laitue a apporté son fusil seulement pour nous le faire voir et nous faire bisquer mais il ne jouera pas avec nous. D’ailleurs il ne sait même pas jouer tout seul. La Laitue est un cochon. Et puis son fusil, c’est de la camelote !
- Il ne joue pas parce qu’il a peur de nous », dit un troisième.
Et celui qui avait parlé avant :
« Peut-être, mais n’empêche que c’est un dégoûtant ! »
Mme Klara était assise sur un banc, occupée à tricoter, et le soleil la nimbait d’un halo. Son petit garçon était assis, bêtement désœuvré, à côté d’elle, il n’osait pas se risquer dans l’allée avec son fusil et il le manipulait avec maladresse. Il était environ trois heures et dans les arbres de nombreux oiseaux, inconnus faisaient un tapage invraisemblable, signe peut-être que le crépuscule approchait.
« Allons Dolfi, va jouer, l’encourageait Mme Klara sans lever les yeux de son travail.
- Jouer avec qui ?
- Mais avec les autres petits garçons, voyons ! vous êtes tous amis, non ?
- Non, on n’est pas amis, disait Dolfi. Quand je vais jouer ils se moquent de moi.
- Tu dis cela parce qu’ils t’appellent Laitue ?
- Je ne veux pas qu’ils m’appellent Laitue !
- Pourtant moi je trouve que c’est un joli nom. A ta place, je ne me fâcherais pas pour si peu. » Mais lui, obstiné :
« Je veux pas qu’on m’appelle Laitue ! »
Les autres enfants jouaient habituellement à la guerre et ce jour-là aussi. Dolfi avait tenté une fois de se joindre à eux, mais aussitôt ils l’avaient appelé Laitue et s’étaient mis à rire. Ils étaient presque tous blonds, lui au contraire était brun, avec une petite mèche qui lui retombait sur le front en virgule. Les autres avaient de bonnes grosses jambes, lui au contraire avait de vraies flûtes maigres et grêles. Les autres couraient et sautaient comme des lapins, lui, avec sa meilleure volonté, ne réussissait pas à les suivre. Ils avaient des fusils, des sabres, des frondes, des arcs, des sarbacanes, des casques. Le fils de l’ingénieur Weiss avait même une cuirasse brillante comme celle des hussards. Les autres, qui avaient pourtant le même âge que lui, connaissaient une quantité de gros mots très énergiques et il n’osait pas les répéter. Ils étaient forts et lui si faible.
Mais cette fois lui aussi était venu avec un fusil.
C’est alors qu’après avoir tenu conciliabule les autres garçons s’approchèrent :
« Tu as un très beau fusil, dit Max, le fils de l’ingénieur Weiss. Fais voir. »
Dolfi sans le lâcher laissa l’autre l’examiner.
« Pas mal », reconnut Max avec l’autorité d’un expert.
Il portait à la bandoulière une carabine à air comprimé qui coûtait au moins vingt fois plus que le fusil. Dolfi en fut très flatté.
« Avec ce fusil, toi aussi tu peux faire la guerre, dit Walter en baissant les paupières avec condescendance.
- Mais oui, avec ce fusil, tu peux être capitaine », dit un troisième.
Et Dolfi les regardait émerveillé. Ils ne l’avaient pas encore appelé Laitue. Il commença à s’enhardir.
Alors ils lui expliquèrent comment ils allaient faire la guerre ce jour-là. Il y avait l’armée du général Max qui occupait la montagne et il y avait l’armée du général Walter qui tenterait de forcer le passage. Les montagnes étaient en réalité deux talus herbeux recouverts de buissons ; et le passage était constitué par une petite allée en pente. Dolfi fut affecté à l’armée de Walter avec le grade de capitaine. Et puis les deux formations se séparèrent, chacune allant préparer en secret ses propres plans de bataille.
Pour la première fois, Dolfi se vit prendre au sérieux par les autres garçons. Walter lui confia une mission de grande responsabilité : il commanderait l’avant-garde. Ils lui donnèrent comme escorte deux bambins à l’air sournois armés de fronde et ils l’expédièrent en tête de l’armée, avec l’ordre de sonder le passage. Walter et les autres lui souriaient avec gentillesse. D’une façon presque excessive.
Alors Dolfi se dirigea vers la petite allée qui descendait en pente rapide. Des deux côtés, les rives herbeuses avec leurs buissons. Il était clair que les ennemis, commandés par Max, avaient dû tendre une embuscade en se cachant derrière les arbres. Mais on n’apercevait rien de suspect.
« Hé ! capitaine Dolfi, pars immédiatement à l’attaque, les autres n’ont sûrement pas encore eu le temps d’arriver, ordonna Walter sur un ton confidentiel. Aussitôt que tu es arrivé en bas, nous accourons et nous y soutenons leur assaut. Mais toi, cours, cours le plus vite que tu peux, on ne sait jamais… »
Dolfi se retourna pour le regarder. Il remarqua que tant Walter que ses autres compagnons d’armes avaient un étrange sourire. Il eut un instant d’hésitation.
« Qu’est-ce qu’il y a ? demanda-t-il.
- Allons, capitaine, à l’attaque ! » intima le général.
Au même moment, de l’autre côté du fleuve invisible, passa une fanfare militaire. Les palpitations émouvantes de la trompette pénétrèrent comme un flot de vie dans le cœur de Dolfi qui serra fièrement son ridicule petit fusil et se sentit appelé par la gloire.
« A l’attaque, les enfants ! » cria-t-il, comme il n’aurait jamais eu le courage de le faire dans des conditions normales.
Et il se jeta en courant dans la petite allée en pente.
Au même moment un éclat de rire sauvage éclata derrière lui. Mais il n’eut pas le temps de se retourner. Il était déjà lancé et d’un seul coup il sentit son pied retenu. A dix centimètre du sol, ils avaient tendu une ficelle.
Il s’étala de tout son long par terre, se cognant douloureusement le nez. Le fusil lui échappa des mains. Un tumulte de cris et de coups se mêla aux échos ardents de la fanfare. Il essaya de se relever mais les ennemis débouchèrent des buissons et le bombardèrent de terrifiantes balles d’argile pétrie avec de l’eau. Un de ces projectiles le frappa en plein sur l’oreille le faisant trébucher de nouveau. Alors ils sautèrent tous sur lui et le piétinèrent. Même Walter, son général, même ses compagnons d’armes !
« Tiens ! attrape, capitaine Laitue. »
Enfin il sentit que les autres s’enfuyaient, le son héroïque de la fanfare s’estompait au-delà du fleuve. Secoué par des sanglots désespérés ils chercha tout autour de lui son fusil. Il le ramassa. Ce n’était plus qu’un tronçon de métal tordu. Quelqu’un avait fait sauter le canon, il ne pouvait plus servir à rien.
Avec cette douloureuse relique à la main, saignant du nez, les genoux couronnés, couvert de terre de la tête aux pieds, il alla retrouver sa maman dans l’allée.
« Mon Dieu ! Dolfi, qu’est-ce que tu as fait ? »
Elle ne lui demandait pas ce que les autres lui avaient fait mais ce qu’il avait fait, lui. Instinctif dépit de la brave ménagère qui voit un vêtement complètement perdu. Mais il y avait aussi l’humiliation de la mère : quel pauvre homme deviendrait ce malheureux bambin ? Quelle misérable destinée l’attendait ? Pourquoi n’avait-elle pas mis au monde, elle aussi, un de ces garçons blonds et robustes qui couraient dans le jardin ? Pourquoi Dolfi restait-il si rachitique ? Pourquoi était-il toujours si pâle ? Pourquoi était-il si peu sympathique aux autres ? Pourquoi n’avait-il pas de sang dans les veines et se laissait-il toujours mener par les autres et conduire par le bout du nez ? Elle essaya d’imaginer son fils dans quinze, vingt ans. Elle aurait aimé se le représenter en uniforme, à la tête d’un escadron de cavalerie, ou donnant le bras à une superbe jeune fille, ou patron d’une belle boutique, ou officier de marine. Mais elle n’y arrivait pas. Elle le voyait toujours assis un porte-plume à la main, avec de grandes feuilles de papier devant lui, penché sur le banc de l’école, penché sur la table de la maison, penché sur le bureau d’une étude poussiéreuse. Un bureaucrate, un petit homme terne. Il serait toujours un pauvre diable, vaincu par la vie.
« Oh ! le pauvre petit ! » s’apitoya une jeune femme élégante qui parlait avec Mme Klara.
Et secouant la tête, elle caressa le visage défait de Dolfi.
Le garçon leva les yeux, reconnaissant, il essaya de sourire, et une sorte de lumière éclaira un bref instant son visage pâle. Il y avait toute l’amère solitude d’une créature fragile, innocente, humiliée, sans défense ; le désir désespéré d’un peu de consolation ; un sentiment pur, douloureux et très beau qu’il était impossible de définir. Pendant un instant – et ce fut la dernière fois – il fut un petit garçon doux, tendre et malheureux, qui ne comprenait pas et demandait au monde environnant un peu de bonté.
Mais ce ne fut qu’un instant.
« Allons, Dolfi, viens te changer ! » fit la mère en colère, et elle le traîna énergiquement à la maison.
Alors le bambin se remit à sangloter à cœur fendre, son visage devint subitement laid, un rictus dur lui plissa la bouche.
« Oh ! ces enfants ! quelles histoires ils font pour un rien ! s’exclama l’autre dame agacée en les quittant. Allons, au-revoir, madame Hitler ! »







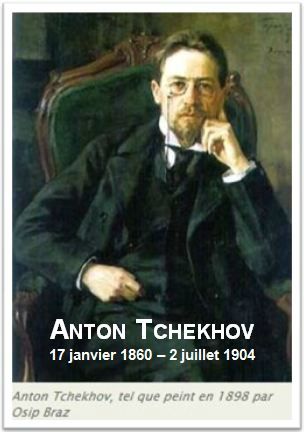
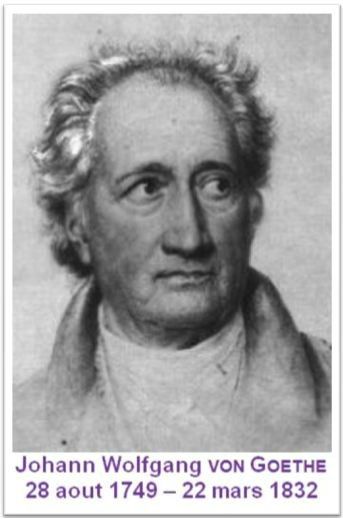




















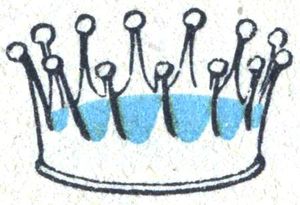














/https%3A%2F%2Fprofilepics.canalblog.com%2Fprofilepics%2F1%2F0%2F1057085.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F26%2F38%2F1135807%2F87631001_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F20%2F99%2F1135807%2F87499895_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F67%2F26%2F1135807%2F87438795_o.jpg)